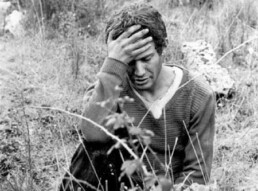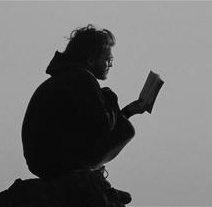Internetrecht Teil I: die Marke und der Domain-Name.
(it)Um in diese Thematik einsteigen zu können, ist es notwendig, vorab einige Begriffe zu betrachten, die sowohl das Arbeitsrecht als auch die üblichen Regeln der Internet-Welt berühren.
Zunächst ist zu prüfen, wie der Domänenname im Rahmen derItalienisches System. Der Gesetzgeber
regelte diese Zahl zum ersten Mal mit Art. 22 des IPC (Gesetzbuch des gewerblichen Eigentums), der das Verbot einführte, als "ein Domain-Name ein Zeichen, das mit einer fremden Marke identisch oder ihr ähnlich ist, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit zwischen den Inhabern dieser Zeichen und den Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke benutzt wird, für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die auch in der Gefahr bestehen kann, dass die beiden Zeichen gedanklich in Verbindung gebracht werden".
Der Domain-Name kann daher auch als unterscheidungskräftiges Zeichen relevant sein, da der Unternehmer angesichts der fortschreitenden "Kommerzialisierung" des Internets nicht mehr irgendeinen Domain-Namen verwendet, sondern eine spezifische Internet-Adresse benötigt, um die auf seiner kommerziellen Website angebotenen Produkte oder Dienstleistungen für Surfer erkennbar zu machen.
Die Doktrin und die Rechtsprechung haben schon vor der Einführung der oben genannten Definition im Rahmen des c.p.i. die Unterscheidungskraft des Domänennamens anerkannt, indem sie feststellten, dass "es erscheint nicht gerechtfertigt zu bestreiten, dass der Domain-Name im vorliegenden Fall auch eine Unterscheidungskraft für den Nutzer der Website hat, die zur Identifizierung derselben und der von ihr der Öffentlichkeit über die Verbindung von Netzen (Internet) angebotenen kommerziellen Dienstleistungen beitragen kann, mit einer gewissen offensichtlichen Affinität zur Figur des Zeichens als dem (virtuellen) Ort, an dem der Unternehmer mit dem Kunden in Kontakt tritt und den Vertrag mit ihm abschließt".[1]
Diese Auslegung wird nach der Einführung des oben erwähnten Artikels 22 IPC durch eine kürzlich ergangene Entscheidung des Mailänder Gerichtshofs vom 20. Februar 2009 erneut bestätigt, in der die vorherrschende Rechtsprechung zugunsten der Anerkennung der Unterscheidungskraft des vor der IPC gebildeten Domänennamens endgültig bestätigt wird.[2]
Flankiert werden die Markenschutzbestimmungen auch durch die Netzregeln. Im Internet gilt nämlich der Grundsatz der "wer zuerst kommt, mahlt zuerst", in auf deren Grundlage ein Domänenname an den ersten Antragsteller vergeben wird, unabhängig davon, ob er mit den Rechten anderer kollidiert. Die Domänenzuteilungsstellen sind nicht verpflichtet, eine Vorabkontrolle durchzuführen, um eine Registrierung zu verhindern/zu vermeiden - wie z. B. Domänenname - von Zeichen oder Marken, die einer eingetragenen Marke zum Verwechseln ähnlich sind, durch eine andere Person als den Inhaber des unterscheidungskräftigen Zeichens. Mit anderen Worten: Nach der derzeitigen Methode der Zuteilung von Domänennamen, alle noch nicht registrierten Namen (wie Domänenname) sind auf der Grundlage der Priorität von Anmeldungen für jedermann frei eintragbar, unabhängig davon, ob diese Namen mehr oder weniger bekannten Namen oder Kennzeichen Dritter entsprechen.
An dieser Stelle ist es notwendig, die tatsächliche Methode der Anwendung dieser Regeln zu analysieren, und dazu ist es erforderlich, die Marken in zwei Makrogruppen zu unterteilen, nämlich in nicht bekannte und bekannte Marken.
(a) Fälle, in denen es sich um eine nicht geschützte Marke von morgen handelt
Im ersten Fall, wenn die Domain-Name identisch oder ähnlich mit der nicht bekannten Marke einer anderen Person ist, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein, damit diese Person die Verwendung dieses Domänennamens verhindern kann:
- l'Identität oder Ähnlichkeit der Marke mit dem Domänennamen (z. B. die eingetragene Marke ist ABCD s.r.l. und der Dritte verwendet einen übereinstimmenden Domänennamen www.abcd.it);
- l'Identität oder Ähnlichkeit von Produkten oder Dienstleistungen angeboten. (beide sind im gleichen Marktsegment tätig);
In diesem Fall gilt der in Artikel 2569 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorgesehene und geregelte Grundsatz der Spezialität des Markenschutzes.[3] und Artikel 20 Absatz 1 c.p.i. (a) und (b).
Es liegt auf der Hand: Je näher die angebotenen Produkte und Dienstleistungen beieinander liegen, desto größer ist die Verwirrung in der Öffentlichkeit darüber, woher sie eigentlich kommen.
Deshalb, auch wenn es gibt keine Identität zwischen den Produktbereichen der nicht bekannten Marke und der Domain-Namewenn die Bösgläubigkeit des Inhabers des Domänennamens, so wird diese Tätigkeit als geeignet angesehen, den Inhaber der Marke daran zu hindern, sie im Internet als weiteres Unterscheidungszeichen zu benutzen, und ist daher nach Artikel 22 der Zivilprozessordnung zu beanstanden. [4]
(b) Fälle, in denen morgen der Name einer bekannten Marke verwendet wird
Im Falle einer bekannten oder sehr bekannten Marke gilt die Verwendung eines der Marke ähnlichen Domänennamens als unangemessen, wenn die Verwendung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.[5]
ABSTRACT
- Der Gesetzgeber hat den Domänennamen zum ersten Mal in Art. 22 c.p.i. (Gesetzbuch des gewerblichen Eigentums) geregelt.
- die vorherrschende Rechtsauffassung zugunsten der Anerkennung der Unterscheidungskraft des Domänennamens
- in Fällen von Domain-Name eines nicht anerkannten Markennamens, wenn die Domain-Name mit einer fremden Marke identisch oder ähnlich ist, ist es erforderlich, dass die Identität oder Ähnlichkeit der Marke mit dem Domainnamen und die Identität oder Ähnlichkeit der angebotenen Waren oder Dienstleistungen gegeben ist, um die Benutzung dieses Domainnamens zu verhindern
- in Fällen von Domain-Name einer bekannten Marke, wird es als unangemessen angesehen, die Domain-Name die der Marke ähnlich sind, auch im Falle der Benutzung von Zeichen für Waren und Dienstleistungen, die nicht ähnlich sind, wenn die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt
[1] Gericht von Mailand, Beschluss vom 10. Juni 1997 - Amadeus Marketing SA, Amadeus Marketing Italia s.r.l. c. Logica s.r.l.
[2] "Der Domain-Name hat einen doppelten Charakter, nämlich einen technischen für die Adressierung der logischen Ressourcen des Internet-Netzes und einen unterscheidungskräftigen. Als unterscheidungskräftiges Zeichen - bestehend aus dem den Domainnamen kennzeichnenden Teil, der Second Level Domain genannt wird - kann er in Anwendung des in Art. 22 c.p.i. verankerten Grundsatzes der Einheitlichkeit von unterscheidungskräftigen Zeichen mit anderen Zeichen in Konflikt geraten". Tribunale Mailand, 20.02.2009, Soc. Solatube Global Marketing Inc. und andere gegen Soc. Solar Proiect und andere.
[3] Art. 2569, Abs. 1. c.c.[3] "Wer eine neue Marke, die zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen geeignet ist, in der gesetzlich vorgeschriebenen Form eingetragen hat, hat das Recht, sie ausschließlich für die Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, für die sie eingetragen ist".
[4] Gericht Mailand, Beschluss vom 10. Juni 1997: "Die als Domain-Grabbing bezeichnete rechtswidrige Verwechslungspraxis, die darin besteht, die Marke eines anderen als Domain-Namen bei der Benennungsbehörde einzutragen, um sich die Bekanntheit des Zeichens anzueignen, stellt als solche eine - gemäß Art. 22 IPC strafbare - Verletzungshandlung dar, und zwar auch insoweit, als es sich um eine Tätigkeit handelt, die geeignet ist, den Inhaber der Marke daran zu hindern, diese im Internet als weiteres Unterscheidungszeichen zu benutzen.
[5] Gericht Mailand, 20.02.2009 "Die als Domain-Grabbing bezeichnete rechtswidrige Verwechslungspraxis, die darin besteht, eine fremde Marke bei der Benennungsbehörde als Domain-Name zu registrieren, um sich den Ruf des Zeichens anzueignen, stellt als solche eine - nach Artikel 22 der Strafprozessordnung strafbare - Verletzungshandlung dar, auch soweit es sich um eine Tätigkeit handelt, die geeignet ist, den Inhaber der Marke daran zu hindern, diese im Internet als weiteres Unterscheidungszeichen zu benutzen"; Gericht Modena, 18.10.2005 "Die Zuweisung eines Domain-Namens (Website-Namens), der einer Marke entspricht - auch wenn er nur de facto bekannt ist -, kann eine widerrechtliche Aneignung des Zeichens und unlauteren Wettbewerb darstellen, da sie den unmittelbaren Vorteil mit sich bringt, die eigene Tätigkeit mit der des Markeninhabers zu verknüpfen, den Ruf des Zeichens auszunutzen und daraus einen unlauteren Vorteil zu ziehen. Im Übrigen steht der Verletzung einer Marke - durch ihre Verwendung als Domain-Name einer Internetseite - weder der Umstand entgegen, dass diese Verwendung von der zuständigen Behörde für die Registrierung von Domain-Namen genehmigt worden ist, noch der Umstand, dass der Inhaber der Marke denselben Namen nicht zuvor bei dieser Behörde registriert hat.".
[:]
Die contemplatio domini bei Verträgen, die von Verwaltern geschlossen werden.
(it)In der Rechtsprechung und Lehre gilt der Grundsatz: ".... auch im Falle der sozialen Repräsentation ist die contemplatio domini erforderlich, so dass, wenn die Der Vertreter eines Unternehmens verwendet nicht dessen Namen, die Shop mit demselben Ergebnis keine Auswirkungen auf das Unternehmen selbst hat
."[1]
Lehre und Rechtsprechung sind sich einig, dass die in Art. 1388 des Zivilgesetzbuches geregelte gesetzliche Bestimmung (".der vom Vertreter geschlossene Vertrag"), gilt sinngemäß auch für die organische Vertretung, die gerade in Bezug auf Personen, die den Status von Vertretungsorganen juristischer Personen haben, gestaltet werden kann.[2]
Anforderungen Für die Wirksamkeit des vom Auftraggeber abgeschlossenen Vertrags gibt es im Wesentlichen drei Voraussetzungen:
1) die Beitrag der repräsentativen Macht;
(2) die Tätigkeit des Vertreters im Rahmen der Proxy;
(3) der Umstand, dass der Dritte durch den Vertreter selbst darauf aufmerksam gemacht wird, dass die vertragliche Vereinbarung auf den Auftraggeber bezogen ist (contemplatio domini);
Es ist daher erforderlich, dass alle drei Elemente existieren zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses Fehlt auch nur eine dieser Voraussetzungen, so ist das Geschäft nur gegenüber dem Auftraggeber wirksam.
Der Schwerpunkt liegt auf dem grundlegenden Erfordernis der contemplatio dominiEs ist hervorzuheben, dass ein solches Element die doppelte Funktion hat, das zwischen dem Vertreter und dem Unternehmer bestehende Vertretungsverhältnis nach außen zu verlagern und folglich die Zurechnung der Wirkungen des in seinem Namen geschlossenen Vertrags durch den Vertreter zu ermöglichen.
Nach der maßgeblichen Rechtsprechung ist die Verwendung des Namens des Auftraggebers in Verträgen, die Schriftform ad substantiam muss in Expressmodus kann nicht allein aus mutmaßlichen Elementen abgeleitet werden.
Bei solchen Verträgen erfordert der Grundsatz, dass alle wesentlichen Bestandteile des Vertrags aus dem Vertrag hervorgehen müssen, dass die Ausgabe des Namens des Auftraggebers auch Ergebnis ad substantiam aus demselben Dokument in dem der Vertrag enthalten ist.[3]
ABSTRACT
- Die contemplatio domini ist auch im Falle der sozialen Vertretung erforderlich.
- für die Wirksamkeit des vom Vollmachtgeber geschlossenen Vertrags die Erteilung einer Vertretungsvollmacht erforderlich ist, der Vertreter im Rahmen der Vollmacht handelt, die contemplatio domini
- in Verträgen, die der Schriftform unterliegen ad substantiam die contemplatio muss ausdrücklich angegeben werden, da sie nicht allein aus vermuteten Elementen abgeleitet werden kann
[1] Zivilkassation, Abteilung II, 30/03/2000, Nr. 3903Siehe auch Zivilkassation, 25/10/1985, Nr. 5271 ".Verwendet der Vertreter einer faktischen Personengesellschaft nicht den Namen des oder der anderen Gesellschafter, so ist das abgeschlossene Geschäft nur gegenüber diesem Vertreter wirksam, auch wenn es sich auf gemeinsame Interessen oder Vermögen bezieht;
[2] In diesem Sinne ist die DE NOVA, Der VertragBd. X des Vertrags über das Privatrecht, unter der Leitung von P. Rescigno, Utet, Turin, 2002, S. 10;SANTORO-PASSARELLI, Allgemeine Lehren des ZivilrechtsJovene, 1986 S. 288; in der Rechtsprechung für alle Cass. vom 18. Juni 1987, Nr. 5371, in Giur. it., 1989, I, 1, 1056
[3] "Bei Verträgen, die vom Handelsvertreter geschlossen werden, [...] kann in Ermangelung einer ausdrücklichen Nennung des Namens des Handelsvertreters, in dem Fall, dass die Wirkungen des Geschäfts dem Handelsvertreter unmittelbar zugerechnet werden, auch wenn die andere Vertragspartei von der Befugnis oder dem Interesse des Handelsvertreters am Abschluss des Geschäfts Kenntnis hatte [...], eine stillschweigende contemplatio domini nicht aus Vermutungen abgeleitet werden.". (Zivilkassation, Sek. II, 12/01/2007, Nr. 433)
[:]
Konferenz über den Agenturvertrag in der Stadtbibliothek.
(it)Freitag, 8. Juni, 15.00 Uhr am Öffentliche Bibliothek Verona Konferenz über den Agenturvertrag statt, die ich in Zusammenarbeit mit den folgenden Partnern organisieren durfte Veronalegal. Als Redner nahmen teil dieRechtsanwalt Valerio Sangiovanni (Rechtsanwalt in Mailand), Dr. Maura Mancini (Arbeitsrichterin am Gericht von Brescia), FrauRechtsanwalt Eve Tessera (französischer Rechtsanwalt, eingetragen in Verona) und der Unterzeichner.
Die folgenden Themen wurden behandelt:
- Studie über ein Agenturvertrag (Rechtsanwalt Valerio Sangiovanni)
- Abfindung gemäß Artikel 1751 des Zivilgesetzbuches (Dr. Maura Mancini)
- der Agenturvertrag in Frankreich (Befürworterin Eve Tessera)
- der Agenturvertrag in Deutschland (meine Wenigkeit...)
Ich möchte allen Teilnehmern der Konferenz und den Referenten, die sich nicht nur als äußerst kompetent, sondern auch als sehr klar und hilfreich erwiesen haben, aufrichtig danken.
[:]
Art. 1451 des Zivilgesetzbuches Durchsetzbarkeit des simulierten Geschäfts gegenüber Dritten.
[:de]Gemäß demArtikel 1415 des Zivilgesetzbuches. Simulation 'kann weder von den Vertragsparteien noch von den Rechtsnachfolgern oder den Gläubigern des simulierten Ausländers geltend gemacht werden, um die dritte Parteien die gutgläubig Rechte vom scheinbaren Eigentümer erworben haben".Im Wesentlichen geht es darum, den Dritten gegenüber den Parteien zu schützen, indem die Vorherrschen des Vertrauens, dass Drittenach Treu und Glauben in der Lage waren, die das äußere Erscheinungsbild des Vertrags.
Die Rechtsprechung hat sich zu diesem Thema wie folgt geäußert: "dass die Simulation nicht gegenüber Dritten durchsetzbar ist, die in gutem Glauben Rechte von dem scheinbaren Eigentümer erworben haben, ist erforderlich dass die der Dritte ist der Inhaber einer verbundenen oder abhängigen Rechtsstellung oder dass es in irgendeiner Weise sein kann beeinflusst durch die simulative Vereinbarung".[1]
Die Rechtsprechung ist sich einig, dass der Begriff der dritte in Artikel 1415 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist weit und umfassend auszulegen, denn es ist davon auszugehen, dass ausreichend dass es eine bloße Verbindung oder ein einfaches Abhängigkeitsverhältnis zwischen der rechtlichen Situation des Dritten und der simulierten Vereinbarung.
Zum Beispiel kann man lesen "....Artikel 1415 Abs. (1) des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist dahingehend auszulegen, dass die Simulation dem gutgläubigen Dritterwerber, d.h. demjenigen, der sich auf der Grundlage des simulierten Vertrags in Unkenntnis der Beeinträchtigung der Rechte anderer eine günstige Rechtsfolge verschafft, vom Scheininhaber nicht entgegengehalten werden kann...."[2]
In diesem Punkt hat sich dieselbe Doktrin in völliger Übereinstimmung mit der vorgenannten rechtswissenschaftlichen Orientierung geäußert und erklärt, dass für dritte Parteien ehemals Artikel 1415 des Zivilgesetzbuches bezeichnet alle Personen, die eine günstige Rechtswirkung zu erzielen auf der Grundlage des simulierten Vertrags (und dies entspricht der allgemeinen Regel, dass Derjenige, der eine scheinbare Verhandlungssituation schafft, kann die tatsächliche Situation gegenüber gutgläubigen Dritten nicht durchsetzen.[3]
Außerdem ist dies nichts anderes als eine Anwendung des allgemeineren Grundsatzes des Vertrauensschutzes "... Der Grundsatz des Anscheinsrechts, der mit dem allgemeineren Grundsatz des Vertrauensschutzes zusammenhängt, kann geltend gemacht werden, wenn es objektive Anhaltspunkte gibt, die die Überzeugung des Dritten von der Übereinstimmung zwischen der scheinbaren und der tatsächlichen Situation rechtfertigen...".[4]
Zur Gutgläubigkeit des Dritten ist kurz anzumerken, dass die Doktrin[5] und Rechtsprechung[6] stimmen zu, dass der Dritte von der Beweislast befreit ist, da es sich um eine Vermutung handelt.
Schließlich ist festzustellen, dass in dieser Angelegenheit Bösgläubigkeit nicht mit dem "reine Wissenschaft"des Planspiels, sondern mit der Absicht, den Zweck zu erleichtern, zu dem das Planspiel durchgeführt wurde.[7]
Daher muss der Dritte nicht nur seine Gutgläubigkeit nicht nachweisen, sondern es obliegt dem Scheininhaber, seine Bösgläubigkeit zu beweisen.
- Nach Art. 1415 des Zivilgesetzbuches ist der Dritte gegenüber den Parteien geschützt, wobei der Gesetzgeber dem Vertrauen, das der Dritte in gutem Glauben auf den äußeren Anschein des Vertrages gesetzt hat, den Vorrang gegeben hat
- Damit die Simulation gegenüber Dritten, die in gutem Glauben Rechte vom Scheininhaber erworben haben, nicht durchsetzbar ist, muss der Dritte Inhaber einer Rechtsposition sein, die mit der Simulationsvereinbarung zusammenhängt, von ihr abhängt oder in irgendeiner Weise von ihr betroffen ist
- Der Begriff des Dritten in Artikel 1415 des Bürgerlichen Gesetzbuchs muss weit und umfassend ausgelegt werden
- Der Dritte ist von der Beweislast für seine Gutgläubigkeit befreit, da es sich um eine Vermutung handelt, so dass es dem Scheininhaber obliegt, seine Bösgläubigkeit zu beweisen
[3] Vgl. M. Bianca: Zivilrecht - Der Vertrag - Giuffré S. 667;
[5] Mengoni, Kauf bei Nicht-Domination, 1949, 117 und spätere Ausgaben;
[6] Cass. 1949, Nr. 53; Cass. 1960, Nr. 1046; Cass. 1970, Nr. 349; Cass. 1987, Nr. 5143; Cass. 2002, Nr. 3102;
[7] Cass. 1986, Nr. 2004; Cass. 1991, Nr. 13260;
[:]
Anwaltshonorare und zuständige Gerichtsbarkeit.
(it)
Kürzlich, mit dem Urteil des 12.10.2011 n. 2100der Oberste Gerichtshof hat sich mit der Feststellung geäußert, dass "die Vergütung für professionelle Dienstleistungendie nicht konventionell etabliert ist, ist eine illiquide Geldschuldennach dem Berufstarif zu bestimmen ist; daraus folgt, dass die optionale Bohrung des Ortes, an dem die Verpflichtung zu erfüllen ist (Art. 20 c.p.c., zweite Hypothese)'sollten gemäß dem letzten Absatz von Art. 1182 c.c.im Wohnsitz des Schuldners in demselben
Aushilfeo".[1]
Wendet man diesen Grundsatz auf die berufliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts an, so werden die praktischen Auswirkungen des genannten Urteils deutlich. Wie allgemein bekannt, ist Art. 20 c.p.c.die als alternativer Gerichtsstand zum allgemeinen Gerichtsstand des Beklagten gilt (Artikel 18 c.p.c.). stellt fest, dassfür Klagen, die Verpflichtungsrechte zum Gegenstand haben, ist auch das Gericht des Ortes zuständig, an dem [...] die betreffende Verpflichtung zu erfüllen ist".
Nach Ansicht des Obersten Gerichtshofs gilt daher, wenn nicht festgestellt wird, "ab Ursprung"Die Parteien haben einen Anspruch auf Zahlung der Vergütung eines Freiberuflers, der Anspruch kann nicht als liquide bezeichnet werden, da er erst nach der Erbringung der Leistung bestimmt werden kann. Daher ist Artikel 1182 Absatz 3 des Zivilgesetzbuches, der vorsieht, dass ".die Verpflichtung, die sich auf einen Geldbetrag bezieht, muss zum Zeitpunkt der Fälligkeit am Wohnsitz des Gläubigers erfüllt werden."
Angesichts der nicht liquide und bestimmbarer Charakter der Forderung sollte nach Ansicht des Obersten Gerichtshofs stattdessen angewandt werden Artikel 1182 letzter Absatzdie stattdessen die Erfüllung der Verpflichtung am Wohnsitz des Schuldners vorsieht.
Dieser Grundsatz gilt natürlich auch für den Beruf des Rechtsanwalts. Ihre Vergütung lässt sich nämlich meist nicht im Voraus bestimmen, insbesondere wenn es sich um eine gerichtliche Tätigkeit handelt, da die im Laufe des Verfahrens tatsächlich zu verrichtende Tätigkeit nicht vorhersehbar ist. Nach dieser Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs muss ein Rechtsanwalt, der eine Forderung aus seiner eigenen beruflichen Tätigkeit eintreiben will, am Gerichtsstand des Beklagten tätig werden. Art. 18 c.p.c. oder des Schuldners ex art 20 c.p.c.
ABSTRACT
- Eine nicht vereinbarte Vergütung für berufliche Leistungen ist eine nicht liquidierbare Geldschuld, die nach dem Berufstarif zu bestimmen ist.
- Der fakultative Gerichtsstand des Ortes, an dem die Verpflichtung zu erfüllen ist (Art. 20 c.p.c.), ist gemäß Art. 1182 c.c., letzter Absatz, am Wohnsitz des Schuldners zu bestimmen
- Ein Rechtsanwalt, der seine eigene Forderung eintreiben will, muss entweder beim Gericht des Beklagten gemäß Art. 18 c.p.c. oder beim Gericht des Schuldners gemäß Art. 20 c.p.c. tätig werden.
[:]
Zuständigkeit beim internationalen Verkauf von beweglichen Sachen.
(it)
Oftmals unterlassen es die Parteien, die einen internationalen Kaufvertrag über bewegliche Güter abschließen, aus verschiedenen Gründen zu entscheiden und festzulegen, welches Gericht für die Entscheidung eines möglichen Rechtsstreits über den Vertrag selbst zuständig ist.
In Ermangelung einer solchen Wahl müssen die Parameter ermittelt werden, die durch die Verordnung 44/2001. Das Gleiche gilt für die:
- das Gericht, in dessen Bezirk der Beklagte seinen Wohnsitz hat, für die Entscheidung zuständig ist (Art. 2.1);
- "Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, kann in einem anderen Mitgliedstaat verklagt werden", und zwar im Falle des Verkaufs von Waren "an dem in einem Mitgliedstaat gelegenen Ort, an dem die Waren geliefert worden sind oder nach dem Vertrag hätten geliefert werden müssen" (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b)).
Beispiel: Ein italienisches Unternehmen verkauft Waren an ein schwedisches Unternehmen. Die Parteien vereinbaren, dass die Waren an einen in Spanien ansässigen Händler geliefert werden sollen. Das schwedische Unternehmen liefert die Waren pünktlich, aber das schwedische Unternehmen versäumt es, die Leistung zu erbringen.
Das schwedische Unternehmen will rechtliche Schritte einleiten und hat sich zur Klärung an einen Anwalt gewandt.
Ex .Art. 2,1 Reg. 44/2001 In diesem Fall ist (in Ermangelung einer Rechtswahl der Parteien) die Gerichtsbarkeit des Beklagten, d. h. die schwedische Gerichtsbarkeit, zuständig.
In jedem Fall ist dieArtikel 5 Absatz 1 Buchstabe b sieht als besonderen Gerichtsstand das Gericht des Ortes vor, an dem die Waren geliefert wurden oder hätten geliefert werden müssen (Spanien).
Daher hat der italienische Verkäufer (zu seiner Überraschung) in Italien kein Klagerecht, um die Bezahlung seiner Waren zu verlangen.
Es ist wichtig zu betonen, dass nach einer Vereinigte Sektionen des Obersten GerichtshofsDieser Grundsatz ist auch dann anwendbar, wenn der Verkäufer beabsichtigt, auf die bloße Zahlung der Gegenleistung zu klagen.
Hierzu erklärte der Oberste Gerichtshof, dassauf dem Gebiet des internationalen Warenkaufs, Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b) des EG-Verordnung Nr. 44/2001 vom 22. Dezember 2000 ist dahin auszulegen, dass bei Kaufverträgen unter der mit der Klage geltend gemachten Verpflichtung nicht die vom Kläger geltend gemachte Verpflichtung zu verstehen ist, sondern die den Vertrag kennzeichnende Verpflichtung, also bei Warenverkaufsverträgen diejenige zur Lieferung der Ware; Daher ist auch im Falle einer Klage, die sich auf die bloße Zahlung der Gegenleistung bezieht, der Ort der Lieferung der Waren für die Zwecke der gerichtlichen Zuständigkeit zu berücksichtigen, der, wenn er nicht im Vertrag festgelegt ist, unter Bezugnahme auf die bereits vom EuGH bestätigten Grundsätze zu bestimmen ist, wobei der Ort nach den Kollisionsnormen des angerufenen Gerichts zu bestimmen ist."[1]
ABSTRACT
in Ermangelung einer Wahlmöglichkeit auch für Fragen der Zahlung der Gegenleistung zuständig ist:
- das Gericht, bei dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat (Art. 2. reg. 44/2001)
- das Gericht, an das die Waren geliefert werden sollten (Art. 5 Reg. 44/2001)
- auch im Fall einer Klage, die sich auf die bloße Zahlung einer Gegenleistung bezieht, ist für die Zuständigkeit der Ort der Lieferung der Ware maßgebend
[1] Zivilkassation 2009 Nr. 3059 Giust. civ. Masse. 2009, 3, 479
[:]
Wahl oder Nichtwahl des anwendbaren Rechts
Einer der ersten Schritte bei der Ausarbeitung eines internationalen Vertrags ist Wahl des anwendbaren Rechts. Erst nach einer solchen Prüfung kann ein Vertrag ordnungsgemäß abgefasst werden, denn nur so können die Parteien einen Vertrag auf der Grundlage der normativen Vorgaben der gewählten Rechtsordnung erstellen.
Dieses Element wird oft "brüskiert" oder in den Hintergrund gedrängt.
von Uneingeweihten als reine Formalität angesehen wird.
In der Regel fügen die Parteien, die eine Zusammenarbeit auf internationaler Ebene aufnehmen wollen, in einen Vertrag das ein, was sie normalerweise in nationale Verträge einfügen, wobei sie manchmal Verträge verwenden, die sie bereits zur Regelung ihrer nationalen Beziehungen verwendet haben.
In der Realität kann eine mangelnde Auswahl zu unangenehmen Überraschungen bei einem oder mehreren Auftragnehmern führen.
Fall 1
Zum besseren Verständnis sollen zwei klassische Beispiele für Probleme angeführt werden, die gerade mit der Nichtwahl des anwendbaren Rechts zusammenhängen.
Ein italienischer Auftraggeber schließt einen Handelsvertretervertrag mit einem französischen Projektträger ab. Die Parteien wählen das anwendbare Recht nicht, da sie es für völlig überflüssig halten. Nach einem Arbeitsverhältnis von vier Jahren stellt der italienische Auftraggeber die Produktion ein. Der französische Agent verlangt daher eine Entschädigung in Höhe von zwei Jahresprovisionen, die sich nach den Regeln des französischen Rechts richtet. In diesem Fall gilt mangels Rechtswahl das Recht des Handelsvertreters, d. h. französisches Recht. Der Auftraggeber stellt nach einem Gespräch mit seinem Anwalt fest, dass nach italienischem Recht die Abgangsentschädigung ist viel niedriger (ex Artikel 1751 des Zivilgesetzbuches "Die Höhe der Vergütung darf einen Betrag nicht überschreiten, der einer jährlichen Vergütung entspricht...) .
Fall 2
Ein italienisches Unternehmen schließt einen Vertrag über die Lieferung von Waren mit einem amerikanischen Unternehmen ab. Im Vertrag ist nichts über das anwendbare Recht festgelegt. Außerdem wird eine Vertragsstrafenklausel vereinbart, die den amerikanischen Verkäufer zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 10.000,00 € im Falle einer verspäteten Lieferung der Waren verpflichtet. Die Ware wird mit mehr als einem Monat Verspätung geliefert, und dennoch will das amerikanische Unternehmen das Zwangsgeld nicht zahlen. Das Unternehmen wendet sich an einen Rechtsanwalt, um eine Klärung der Zwangsgeldmodalitäten zu erwirken. Zur Überraschung des Kunden erklärt ihm der Anwalt, dass die Situation je nach dem anwendbaren Recht sehr unterschiedlich ist. Tatsächlich ist die Zwangsgeldklausel gültig, es sei denn, das Gericht setzt den Betrag herab, wenn er offenkundig überhöht ist (Artikel 1384 des Zivilgesetzbuches.). Im Gegensatz dazu sieht das amerikanische Recht nicht die Möglichkeit vor, Sanktionen zu verhängen (Vertragsstrafe), sondern nur Formen der pauschalen Festsetzung von Schadensersatz (pauschalierter Schadensersatz).
Einer der ersten Schritte bei der Ausarbeitung eines internationalen Vertrags ist Wahl des anwendbaren Rechts. Erst nach einer solchen Prüfung kann ein Vertrag ordnungsgemäß abgefasst werden, denn nur so können die Parteien einen Vertrag auf der Grundlage der normativen Vorgaben der gewählten Rechtsordnung erstellen.
Dieses Element wird oft "brüskiert" oder in den Hintergrund gedrängt.
von Uneingeweihten als reine Formalität angesehen wird.
In der Regel fügen die Parteien, die eine Zusammenarbeit auf internationaler Ebene aufnehmen wollen, in einen Vertrag das ein, was sie normalerweise in nationale Verträge einfügen, wobei sie manchmal Verträge verwenden, die sie bereits zur Regelung ihrer nationalen Beziehungen verwendet haben.
In der Realität kann eine mangelnde Auswahl zu unangenehmen Überraschungen bei einem oder mehreren Auftragnehmern führen.
Die Rechtsform des verbundenen Unternehmens in Italien.
(it)
Es ist inzwischen allgemein bekannt, dass es sich bei den assoziierten Anwaltskanzleien um solche handelt, ohne eigene Rechtspersönlichkeitdie nach der Rechtsprechung "zuInnerhalb dieser Phänomene der Interessenbündelung denen das Gesetz die Fähigkeit zuschreibt, als autonome Zentren der Anrechnung von Beziehungen legal,munites of Rechtsvertretung nach den Vorschriften der Artikel 36 ff. des Zivilgesetzbuches."[1]
Unter Konkursist dieses Merkmal von großer Bedeutung. Nach einer ständigen Orientierung des Obersten Kassationsgerichtshofs verfügen die angeschlossenen Studios nämlich über eine rechtliche Vertretung, keine Privilegien beanspruchen wenn es um die Zulassung zu den Passiva im Konkurs geht. Für den Obersten Gerichtshof ist das Unternehmen in der Tat nicht mit dem individuellen Subjekt gleichzusetzen, das von der'Artikel 2751 bis Nr. 2, wobei dieses Recht keine analoge Erweiterung zulässt.
Eine mögliche Lösung für dieses Problem wäre die Abtretung der Forderung aus den vom einzelnen Rechtsanwalt persönlich erbrachten Leistungen an die Kanzlei. Diese Bedingung muss jedoch in jedem Fall erfüllt und nachgewiesen werden, da sie nicht abstrakt als rechtliche oder natürliche Folge der Beteiligung des Anwalts an der Sozietät, einer autonomen Interessengemeinschaft, angesehen werden kann.[2]
ABSTRACT
das zugehörige italienische Unternehmen:
- ist ein Phänomen der Bündelung von Interessen ohne Rechtspersönlichkeit, aber mit rechtlicher Vertretung;
- im Konkursfall nicht das Privileg des Artikels 2751a Absatz 2 genießt
- eine Abtretung der Forderung aus persönlich erbrachten Leistungen des einzelnen Rechtsanwalts ist weiterhin möglich
[:]
Die Rom-I-Verordnung und das geltende Recht.
(it)
Wenn die Parteien nicht die Recht, dem das Vertragsverhältnis unterliegtdie Anknüpfungskriterien gemäß Artikel 4 der Verordnung Rom I (593/2008)
Insbesondere dieArtikel 4.1 legt eindeutig fest, welches Recht auf eine Reihe von Verträgen anzuwenden ist, bei denen die Parteien keine Wahl getroffen haben (Verkauf, Erbringung von Dienstleistungen, Franchising, Vertrieb). Er lautet nämlich wie folgt:
-
Ein Kaufvertrag über Waren unterliegt dem Recht des Landes, in dem der Verkäufer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;
-
der Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen unterliegt dem Recht des Landes, in dem der Dienstleister seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;
-
ein Vertrag, der ein dingliches Recht an einer unbeweglichen Sache oder die Miete oder Pacht einer unbeweglichen Sache zum Gegenstand hat, unterliegt dem Recht des Staates, in dem die Sache belegen ist;
-
Ungeachtet des Buchstabens c) unterliegt die Vermietung einer Immobilie zum vorübergehenden privaten Gebrauch für einen Zeitraum von höchstens sechs aufeinanderfolgenden Monaten dem Recht des Staates, in dem der Eigentümer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern der Mieter eine natürliche Person ist und seinen gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Staat hat;
-
der Franchisevertrag unterliegt dem Recht des Landes, in dem der Franchisenehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;
-
der Vertriebsvertrag unterliegt dem Recht des Landes, in dem der Vertriebshändler seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;
LArtikel 4 Absatz 2 der VerordnungFällt der Vertrag nicht unter die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Kategorien, so unterliegt er dem Recht des Staates, in dem die Partei, die den Vertrag erfüllen muss, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat;
L'Artikel 4.3Schließlich sieht er vor, dass der Vertrag dem Recht des Staates unterliegt, zu dem er die engsten Verbindungen aufweist, wenn sich das anzuwendende Recht anhand keines dieser Kriterien bestimmen lässt.
ABSTRACT
Falls Sie keine Wahl haben, prüfen Sie:
- ob der Auftrag unter die Kategorien von Art. 4(1) der Rom-I-Verordnung fällt
- andernfalls gilt das Recht, nach dem die Partei die charakteristische Leistung zu erbringen hat
- wenn keines der oben genannten Kriterien die Bestimmung des anwendbaren Rechts ermöglicht, ist der Vertrag dem Recht des Staates unterworfen, zu dem er die engsten Verbindungen aufweist
[:]
Zuständigkeit gemäß EG-Verordnung 44/2001.
(it)
Ein Problem, das sich häufig im Zusammenhang mit Verträgen stellt, die von Parteien mit Wohnsitz oder Sitz in verschiedenen Staaten geschlossen werden, betrifft die Wahl des Gerichtsstands, d. h. die Frage, welches Gericht zuständig ist, wenn die Parteien diese Wahl nicht ausdrücklich getroffen haben.
In Zivil- und Handelssachen zwischen einem italienischen Staatsangehörigen und einem Ausländer muss man erstens
die Beziehungen zu Geschäftspartnern im europäischen Raum und zu Geschäftspartnern in Ländern außerhalb dieses Raums unterscheiden.
- Im ersten Fall sind die europäischen Rechtsvorschriften, die durch die Verordnung 44/2001 (Lugano-Übereinkommen)
- Im zweiten Fall hingegen ist die allgemeine Regelung der Gesetz Nr. 218/1995 zum Internationalen Privatrechtsofern die Angelegenheit nicht unmittelbar durch bilaterale Abkommen der betreffenden Länder geregelt ist.
Nach einer kurzen Analyse der allgemeinen Disziplin, die in der europäischen Verordnung vorgesehen ist, wird festgestellt, dass sie in derArtikel 2.1 die allgemeine Regel der Zuständigkeit des Gerichts des Beklagten.
Nach diesem Grundsatz muss eine Partei, die ihren Wohnsitz in einem EU-Staat hat, in Ermangelung einer Rechtswahl vor dem Gericht dieses Staates verklagt werden.
(z. B. italienischer Kläger, spanischer Beklagter, aber mit Wohnsitz in Belgien, das vertragschließende Gericht ist belgisch)
Die Verordnung 44/2001 sieht jedoch in den Artikeln 5, 6 und 22 der Ausnahmen zu diesem allgemeinen Grundsatz oder:
- Die Artikel 5 und 6 ermöglichen es in einer Reihe von Fällen, eine Person vor anderen Gerichten als denen des Wohnsitzes zu verklagen;
- Artikel 22 sieht eine Reihe von ausschließlichen, d. h. nicht abdingbaren Gerichtsständen vor, die vom Wohnsitz des Beklagten unabhängig sind, z. B. dingliche Rechte an unbeweglichen Sachen, Gültigkeit, Nichtigkeit und Auflösung von Gesellschaften, Eintragung und Gültigkeit von Patenten und Mustern;
- den Parteien steht es jedoch frei, durch eine Gerichtsstandsklausel einen ausschließlichen Gerichtsstand zu wählen (Art. 23).
ABSTRACT
Wenn keine Wahlmöglichkeit besteht und es sich um eine Beziehung zwischen Parteien im europäischen Rechtsraum handelt, welche Gerichte des Staates sind dann zur Entscheidung eines Rechtsstreits berufen?
- Die Verordnung 44/2001 ist zu prüfen.
- Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung 44/2001 regelt den allgemeinen Grundsatz der Zuständigkeit des Gerichts des Beklagten
- Artikel 5 und 6 reg. erlauben in einer Reihe von Fällen, eine Person vor einem anderen Gericht als dem des Wohnsitzes zu verklagen
- Artikel 22 sieht eine Reihe von ausschließlichen, d. h. nicht abdingbaren Gerichtsständen vor, unabhängig vom Wohnsitz des Beklagten
[:]